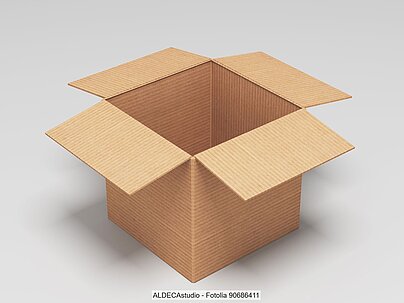Die Tübinger Verpackungssteuer ist im Wesentlichen rechtmäßig. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig heute nach mündlicher Verhandlung entschieden. Die Stadt hatte Revision gegen das Urteil des Verwaltungsgerichtshofes Mannheim zur Verpackungssteuer eingelegt (Az.: BVerwG 9 CN 1.22).
Die Folgen aus dem Urteil über Tübingen hinaus sind unklar. Die Diskussion um kommunale Verpackungssteuern dürfte bundesweit neu entflammen. Dutzende Kommunen in Deutschland hatten ihre Pläne für Verpackungssteuern nach dem Urteil des baden-württembergischen VGH auf Eis gelegt. Tübingen hatte auch deshalb Revision eingelegt, weil sonst auf lange Sicht das Aus für alle kommunalen Versuche zur Einführung einer Verpackungssteuer gedroht hätte.
Anfang vorigen Jahres war in der Universitätsstadt eine Satzung in Kraft getreten, die eine Steuer von maximal 1,50 € pro Mahlzeit auf Einwegverpackungen und Einweggeschirr für Speisen und Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle vorsieht. Tübingen war als Kommune vorgeprescht und wollte die wachsenden Müllberge bekämpfen. Die Betreiberin eines McDonald's-Restaurants in Tübingen hatte dagegen vor dem VGH in Mannheim erfolgreich geklagt. Der Fast-Food-Konzern unterstützt sie dabei. Die Franchise-Nehmerin des Schnellrestaurants berief sich auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1998, nach dem die von der Stadt Kassel 1991 eingeführte Verpackungssteuer auf Einwegverpackungen gegen das damals geltende Abfallrecht des Bundes verstieß.
Bundesverwaltungsgericht: Örtliche Verbrauchsteuer in Zuständigkeit der Stadt
Entgegen der Ansicht der Vorinstanz handelt es sich laut Bundesverwaltungsgericht bei der Verpackungssteuer um eine örtliche Verbrauchsteuer im Sinn des Art. 105 Abs. 2a Satz 1 GG, für deren Einführung die Stadt Tübingen zuständig war. Bei den zum unmittelbaren Verzehr, sei es an Ort und Stelle oder als „take-away“, verkauften Speisen und Getränken ist der Steuertatbestand so begrenzt, dass ihr Konsum – und damit der Verbrauch der zugehörigen Verpackungen – bei typisierender Betrachtung innerhalb des Gemeindegebiets stattfindet. Damit ist der örtliche Charakter der Steuer hinreichend gewahrt.
Die kommunale Verpackungssteuer steht laut Gericht als Lenkungssteuer auch nicht im Widerspruch zum Abfallrecht des Bundes. Sie bezwecke die Vermeidung von Verpackungsabfall im Stadtgebiet und verfolgt damit auf lokaler Ebene kein gegenläufiges, sondern dasselbe Ziel wie der Unions- und der Bundesgesetzgeber. Die Abfallvermeidung stehe in der Abfallhierarchie an oberster Stelle, wie sich aus der EU-Verpackungsrichtlinie, der EU-Einwegkunststoffrichtlinie, dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und dem Verpackungsgesetz ergibt; erst danach folgen Wiederverwendung, Verwertung und Beseitigung des Abfalls. Kommunale Steuern, die Einwegverpackungen verteuern, werden durch die verschiedenen unions- und bundesrechtlichen Vorgaben zum Abfallrecht nicht ausgeschlossen. Soweit das Bundesverfassungsgericht vor 25 Jahren seine gegenteilige Ansicht zur damaligen Kasseler Verpackungssteuer auf ein abfallrechtliches „Kooperationsprinzip“ gestützt hat, lasse sich ein solches dem heutigen Abfallrecht nur noch in – hier nicht maßgeblichen – Ansätzen entnehmen.
Zwar erweisen sich die zu unbestimmte Obergrenze der Besteuerung von 1,50 € pro „Einzelmahlzeit“ und das der Stadtverwaltung ohne zeitliche Begrenzung gewährte Betretungsrecht im Rahmen der Steueraufsicht als rechtswidrig. Diese punktuellen Verstöße lassen jedoch die Rechtmäßigkeit der Satzung im Übrigen unberührt, befand das Bundesverwaltungsgericht weiter.
Boris Palmer: Hartnäckigkeit hat sich gelohnt
"Das Urteil bestätigt, dass sich unsere Hartnäckigkeit gelohnt hat. Jetzt ist auch rechtlich anerkannt, was wir in Tübingen seit eineinhalb Jahren sehen: Die Verpackungssteuer wirkt, bringt Mehrweg-Lösungen voran und drängt die Müllflut im Stadtbild ganz wesentlich zurück", sagt Oberbürgermeister Boris Palmer. Nach der Änderung der Satzung durch den Gemeinderat in den wenigen Punkten, die das Bundesverwaltungsgericht als rechtswidrig eingestuft hat, wird die Stadtverwaltung die rund 440 betroffenen Betriebe schriftlich auffordern, eine Steuererklärung abzugeben, und auf dieser Grundlage die Steuerbescheide für die Jahre 2022 und 2023 versenden, so der Oberbürgermeister.
Nach Mitteilung der Stadt Tübingen hatte die Einführung einer Steuer auf Verpackungen von Takeaway-Essen und -Getränken im Januar 2022 die Müllmenge in den städtischen Abfalleimern von Tübingen, gemessen am Gewicht, nicht reduziert. Mit diesem Ziel hatte der Gemeinderat die Steuer 2020 verabschiedet. Das Angebot an Mehrweg-Verpackungen sei durch die Steuer aber stark stimuliert, was Tübingen weiterhin zur Stadt in Deutschland mit den meisten Restaurants und Cafés pro Kopf mache, die Essen und Getränke in Mehrwegschalen und -bechern anbieten, verweist die Kommune auf eine neue Doktorarbeit von Stefan Moderau am Lehrstuhl für International Business Taxation der Universität Tübingen.
VKU begrüßt weitere "Handlungsoption"
Der Verband kommunaler Unternehmen begrüßte in einer ersten Reaktion auf das Urteil, dass auch die Kommunen vor Ort mittels ihrer Steuersatzung gegen die Vermüllung der Umwelt durch Einwegverpackungen vorgehen können. „Damit stehen neben dem aus unserer Sicht zentralen Einwegkunststofffonds auf Bundesebene weitere Handlungsoptionen gegen das Littering und für Abfallvermeidung zur Verfügung. Wichtig ist nun, dass diejenigen Städte, die von einer kommunalen Verpackungssteuer Gebrauch machen, die Einnahmen daraus auch tatsächlich für Stadtsauberkeit und kommunale Reinigungsleistungen einsetzen“, so ein VKU-Sprecher.
Die Deutsche Umwelthilfe forderte Städte und Gemeinden auf, dem "Tübinger Erfolgsmodell" zu folgen und den Druck auf Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) zu erhöhen, damit eine bundesweite Einwegabgabe auf "to-go"-Verpackungen eingeführt wird. Von McDonald's forderte sie einen umfassenden Umstieg auf klimafreundliche Mehrweg-Alternativen.
McDonald's bedauerte die Entscheidung des Gerichts und kündigte an, dass die Franchise-Nehmerin eine Verfassungsbeschwerde prüfen wolle. "Aktuell gilt es nun erst einmal, noch die schriftliche Begründung des Gerichts abzuwarten", hieß es vom Konzern. Die Anwälte von McDonald's hatten vor einem bundesweiten Flickenteppich gewarnt, sollte sich Tübingen durchsetzen. "Es wird mindestens 80 Kommunen geben, die Verpackungssteuersatzungen erlassen", sagte Anwalt Peter Bachmann. Für bundesweit tätige Unternehmen wie McDonald's sei das kaum zu bewältigen. Wie viel Steuern die McDonald's-Franchisenehmerin in Tübingen nun zahlen muss, war umstritten. Ihre Anwälte gingen von mindesten 870.000 € für das Jahr 2022 und 670.000 € für dieses Jahr aus. Die Vertreter der Stadt sprachen eher von 200.000 €.
„Faustdicke Überraschung“
Das gegenteilige Urteil des Bundesverwaltungsgerichts gilt selbst für Teilnehmer der Verhandlung als eine „faustdicke Überraschung“, wie EUWID erfuhr. Denn der VGH in Mannheim hatte in seinem Urteil die Tübinger Verpackungssteuer klar verworfen. In einem Eingangsstatement betonte die Vorsitzende Richterin des Bundesverwaltungsgerichtes, Prof. Ulrike Bick, die Größe des Problems. Sie zitierte Zahlen der Deutschen Umwelthilfe, wonach in Deutschland jährlich 2,8 Mrd Einwegbecher verbraucht würden. "Diese enorme Zahl zeigt, dass es nicht nur ein Abfall- sondern auch ein Ressourcenproblem ist."
Der VGH hatte der Stadt bereits die Kompetenz zur Einführung der Verpackungssteuer abgesprochen, da es sich nicht um eine örtliche Steuer handele. Die Steuer sei nach ihrem Tatbestand nicht auf Verpackungen für Speisen und Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle begrenzt - wie die Kasseler Verpackungssteuer -, sondern erfasse auch den Verkauf der Produkte zum Mitnehmen. Damit sei normativ der örtliche Bezug der Steuer – den die Gesetzgebungskompetenz für örtliche Verbrauchs- und Aufwandsteuern nach Art. 105 Abs. 2 a GG voraussetze – nicht ausreichend sichergestellt. Auch sei es nicht gewährleistet, dass der Verbrauch der Verpackung vor Ort im Gemeindegebiet stattfinde. Bei Produkten zum Mitnehmen sei im Hinblick auf ihre Transportfähigkeit – auch über größere Strecken – ein Verbleiben im Gemeindegebiet nicht gewährleistet. Auch verstoße die Obergrenze der Besteuerung von 1,50 € für „Einzelmahlzeiten" gegen den Grundsatz der Belastungsgleichheit, weil dieser Begriff nicht ausreichend vollzugsfähig sei.
Der VGH hatte auch erklärt, dass mit der Steuer Tübingens das Tor zur Einführung aller möglichen Verbrauchsteuern durch die Gemeinden eröffnet werde. Dies sei durch das Grundgesetz aber ausgeschlossen. Denn Verbrauchsteuern seien Produktionskosten der Wirtschaft, die in einem einheitlichen Wirtschaftsgebiet eine einheitliche Steuergesetzgebung notwendig machten. Zudem stehe die Verpackungssteuer als Lenkungssteuer in Widerspruch zum aktuellen Abfallrecht des Bundes. Der Bundesgesetzgeber habe detaillierte Regelungen zur Vermeidung und Verwertung der gesamten Palette an Verpackungsabfällen und damit auch der Einwegverpackungen, die Gegenstand der Tübinger Verpackungssteuer seien, getroffen. Danach handele es sich beim Verpackungsgesetz um ein geschlossenes System, das Zusatzregelungen durch den kommunalen Gesetzgeber ausschließe.